

Forschung für eine langfristig, quantitativ und qualitativ gesicherte Trinkwasserversorgung in Deutschland
Im Zukunftsprogramm Wasser entwickelt der DVGW – gemeinsam mit allen Akteuren der Wasserversorgung – zukunftssichere Lösungen, damit auch langfristig Trinkwasser in hoher Qualität und ausreichender Menge für alle zur Verfügung steht. Im Jahr 2021 aufgesetzt, greift das Forschungsprogramm drängende Schwerpunktthemen der zukünftigen Trinkwasserversorgung in Deutschland auf – wie die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, ein effizientes und klimaresilientes Asset-Management sowie die Sicherstellung der Wasserqualität. Ziel ist es, Wissenslücken zu identifizieren und zu schließen, innovative Lösungen zu entwickeln und zu erproben sowie eine nachhaltige Nutzung aller Wasserressourcen im Wasserkreislauf für Deutschland zu ermöglichen.

Übergeordnet werden in einem Roadmapping-Prozess eine Zukunftsvision und Handlungsagenda für den Zeitraum bis 2030 erstellt. Zentrales Element der Programmstruktur ist die DVGW-Fachthemen-Arbeit, die in parallellaufenden Teilprojekten drei Innovationsfelder adressiert:
In Einzelprojekten werden spezifische Fragestellungen dieser Themenfelder bearbeitet. Die individuellen Arbeitsprogramme können verschiedene Schwerpunkte haben – von Analysen und klassischer Forschung bis hin zur Entwicklung von Produkten oder der Erstellung von Regelwerken. Wichtig für das gesamte Programm sind Kooperationen mit externen Akteuren, deren Know-How und Wissen einfließen und zum Gelingen der Projekte beitragen sollen. Der Output wiederum wird zielgruppenspezifisch aufbereitet und kommuniziert und der Wissenstransfer sichergestellt.
Die Wasserversorgung steht angesichts gesellschaftlicher, politischer, ökonomischer und technologischer Veränderungen auf lange Sicht großen Herausforderungen gegenüber. Um auch in Zukunft alle ausreichend mit Trinkwasser in hoher Qualität zu versorgen, müssen neue Anforderungen früh erkannt und daraus strukturierte Handlungsbedarfe abgeleitet werden. Hierfür wird die Roadmap „Wasserversorgung 2030“ entwickelt, die aus vier Bausteinen besteht :
Basierend auf den aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technologischen und ökologischen Rahmenbedingungen und deren absehbare Entwicklung wird in einem Stakeholderprozess eine konsensuale und positive Zukunftsvision für die Wasserversorgung in Deutschland entworfen. Diese dient als Zielmarke für die Arbeit im Programm. Damit sollen Trends und Treiber des Wandels der Wasserversorgung strukturiert erfasst und ihre Auswirkungen auf Wasserbedarf und -dargebot sowie Infrastrukturen in Deutschland beschrieben werden. Die Ergebnisse werden zu einem Big Picture zusammengeführt, das mögliche Entwicklungspfade aufzeigt und relevante Steuerungsgrößen und Risikofaktoren sichtbar macht.
Handlungsagenda für die Zukunft der Wasserwirtschaft

Angesichts der wachsenden Herausforderungen, denen wir in Bezug auf Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Umweltschutz gegenüberstehen, ist es von entscheidender Bedeutung, intelligente und langfristige Strategien zu entwickeln, um auch in Zukunft eine sichere Wasserversorgung und einen guten Zustand der Gewässer zu gewährleisten.
Vor diesem Hintergrund haben der DVGW gemeinsam mit der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) unter breiter Beteiligung der Praxis und mit großer Unterstützung der Wissenschaft die Roadmap Wasserwirtschaft 2030 erarbeitet.
Am 7. Dezember 2023 wurde sie veröffentlicht und im Rahmen einer Online-Veranstaltung vorgestellt. [Die Veranstaltungsunterlagen wurden auf der Roadmap-Webseite zur Verfügung gestellt. Die Aufzeichnung ist ebenfalls dort zu finden.]
Während am Erarbeitungsprozess beteiligte Expertinnen und Experten die strategischen Schwerpunkte der Handlungsagenda präsentierten, sah das Programm einen hochrangig besetzten Talk vor, der die Anschlussfähigkeit der Handlungsagenda in Praxis und Politik beleuchtete.

Vorstellung der Vision 2100 im DVGW Wasser Lunch & Learn
Die Vision einer wasserbewussten Gesellschaft für das Jahr 2100 war am Weltwassertag von Arnd Wendland, Bereichsleiter Werke bei HAMBURG WASSER, im Wasser Lunch & Learn vorgestellt worden. Er hatte den Erarbeitungsprozess mit begleitet und erläuterte, was die Vision 2100 speziell für Hamburg bedeutet.
Sie haben den Termin verpasst? Hier können Sie die Aufzeichnung des DVGW Wasser Lunch & Learn: Die Zukunft der Trinkwasserversorgung - Unser Vision 2100 ansehen.

Die Folgen des Klimawandels sind spürbar - auch in Deutschland. Trockenjahre und Flutkatastrophen haben das sichtbar gemacht. Intensität und Frequenz der auftretenden Ereignisse sowie deren Folgen sind ein zentraler Bestandteil dieses Themenbereichs. Denn diese Art der Extremereignisse und ihre Auswirkungen gehen auch an der Wasserversorgung nicht spurlos vorbei und erfordern Anpassungsmaßnahmen.
Um die Wasserversorgung dauerhaft sicherzustellen, ist es notwendig handlungsrelevante Daten und Erhebungssystematiken bereitzustellen, die in Einzelprojekten erarbeitet werden. Weiterhin ist vorgesehen Managementkonzepte und -werkzeuge zu entwickeln, um Dynamiken und Abläufe des Klimawandels sowie die Einflüsse auf die Wasserversorgung besser zu verstehen und prognostizieren zu können. Prognosen zu Dargebot und Bedarf sowie Modelle für Wasserversorgungskonzepte runden das Bild ab.
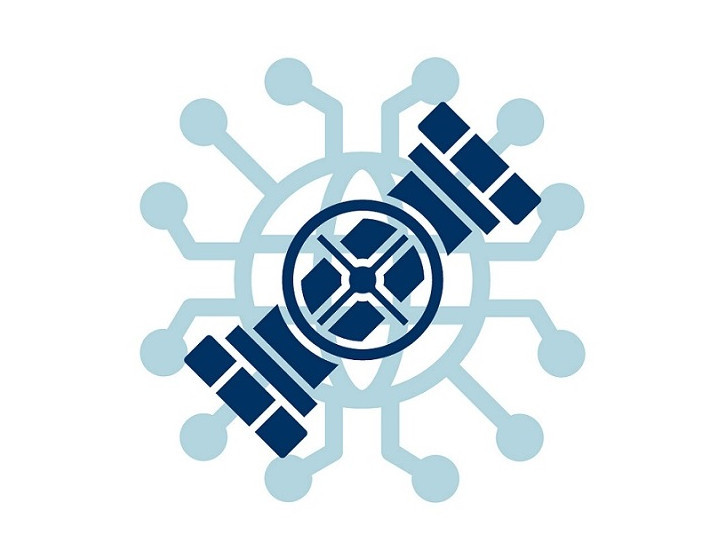
Eine große Herausforderung der Wasserversorgung ist der Funktions- und Werterhalt sowie die Anpassung der Trinkwasserinfrastruktur in den kommenden Jahren. Durch die veränderten Rahmenbedingungen bzw. Nutzungsszenarien und deren Einfluss auf die zukünftige Wasserinfrastruktur ist ein integriertes Asset-Management mit ergänzenden Technologien, wie z.B. der Digitalisierung, bei großen und kleinen Wasserversorgern essenziell für die Bewältigung der komplexen Aufgabenstellungen.
Die Wasserversorgung benötigt Werkzeuge für den Werterhalt der vorhandenen Infrastruktur. Anpassung der bestehenden Versorgungssysteme an veränderte Dargebote und Bedarfsmengen sowie höheren Resilienzanforderungen zukunftssicherer Infrastruktur erfordern Analysen, Innovationen und Praxiserprobungen neuer Technologien, Diagnosewerkzeuge und datengetriebener Systemlösungen.
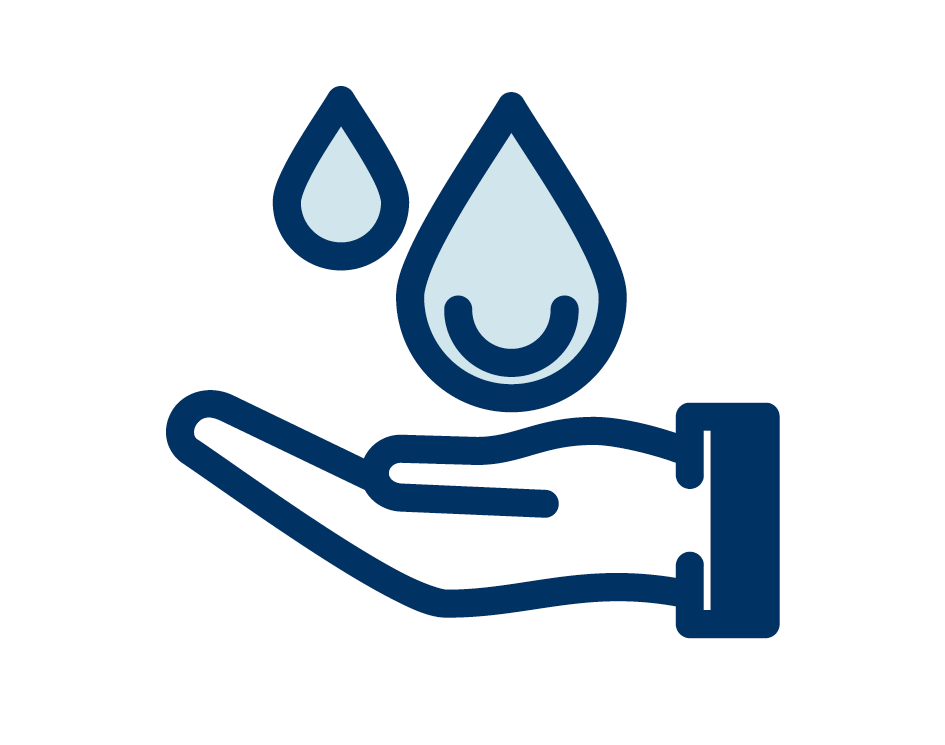
Die Wasserversorgungsbranche in Deutschland ist dazu verpflichtet sicherzustellen, dass durch die Verwendung von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch keine Gefahr für die Gesundheit ausgeht. Dieser Anspruch muss auch in Zeiten eines sich immer deutlicher zeigenden Klimawandels mit einem schnell verändernden Nutzungsverhalten und zunehmender Belastung von Wasserressourcen als oberste Prämisse gewahrt bleiben.
Aus neuen Entwicklungen in der Aufbereitungstechnik, der Spurenanalytik und der Digitalisierung ergeben sich einerseits Herausforderungen und Diskussionen aber andererseits auch neue Möglichkeiten und Chancen. In diesem Spannungsfeld liefert dieses Teilprojekt eine Übersicht mit neuen technologischen und methodischen Handlungsoptionen. Schwerpunkte liegen in der Früherkennung chemischer und mikrobiologischer Gefährdungen, in der Bewertung und Interpretation neuer Substanzen sowie in der Entwicklung eines angepassten Risikomanagements und neuer digitaler Werkzeuge.